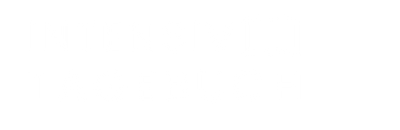Neue Studien
Buch: Erleben im Koma
Dieter Jost war einen Monat im Koma und hat ein Buch darüber geschrieben, das für Betroffene und auch für Angehörige und MitarbeiterInnen sehr lesenswert ist. Es ist im Selbstverlag erschienen, kostet 7 Euro und kann bei ihm direkt bestellt werden: Dieter Jost, Kehlsteinweg 29, 82216 Gernlinden, E-Mail: djost@kabelmail.de.
Tagebuchstudien
Umsetzung von Intensivtagebüchern
PatientInnen auf den Intensivstationen müssen frühzeitig rehabilitiert werden. Basierend auf den jüngsten Erkenntnissen wird ein Maßnahmenbündel der wirksamsten Interventionen empfohlen, um die Rehabilitation zu optimieren, das so genannte abdef-Bündel (Erfassung und Behandlung von Schmerz; sowohl Aufwach- als auch Atemversuche; Wahl von Analgesie und Sedierung; Delir-Bewertung, -Prävention und -Management; Frühzeitige Mobilisierung; Familienintegration; siehe www.iculiberation.com). Drumright et al (2020) aus den USA fügten dem abcdef-Bündel Intensivtagebücher hinzu, um die psychosozialen Bedürfnisse und die Rehabilitation von IntensivpatientInnen zu adressieren. Ein multidisziplinäres Team entwickelte einen Implementierungsplan für die Tagebücher auf der Intensivstation in einem Veterans Affairs Medical Center in den USA. Das Tagebuch wurde chronologisch geschrieben, enthielt Polaroidfotos Fotos mit Zustimmung und war nicht Teil der PatientInnenakte. Es wurde ein Tagebuch-Akzeptanzformular verwendet, das von Verwandten oder PatientInnen danach unterschrieben wurde. Das Studienteam lieferte Beispiele für das Schreiben von Einträgen und andere Unterstützung. Die Zielgruppe waren PatientInnen mit hohem Risiko für ein Post-Intensive-Care-Syndrome und umfassten auch PatientInnen mit Demenz und/oder Delirium. Die meisten Hindernisse waren rechtliche Bedenken des Personals (Antwort: „Es gibt keine Berichte über die Verwendung von Intensivtagebüchern in Gerichtsverfahren."), und das Personal wurde in einer 1 zu 1 Form gebildet. Nach zweijähriger Umsetzung wurden 75 Tagebücher initiiert, wobei 93 % einmal täglich von Pflegenden und 32 % von Familien geschrieben wurden. In einer Vorher-Nachher-Umfrage bewerteten die MitarbeiterInnen das Tagebuch sehr positiv, beschrieben seine positive Wirkung für die PatientInnen und äußerten auch eine erhöhte Besorgnis über die rechtliche und Workflow-Belastung. Auch PatientInnen und Familien schätzen das Tagebuch. Das Tagebuchprojekt könnte einen Einfluss auf die Kultur der Intensivstation haben, hin zu einer stärkeren Begegnung zwischen Mensch und Mensch. Die AutorInnen schlussfolgern: „Letztendlich hat die Umsetzung von Intensivtagebüchern einen erheblichen Mehrwert für die Erfahrungen, die IntensivpatientInnen machen müssen, indem sie die Pflege humanisiert hat."
Drumright K, Jones AC, Gervasio R, Hill C, Russell M, Boehm LM. Implementation of an Intensive Care Unit Diary Program at a Veterans Affairs Hospital. J Nurs Care Qual. 2020 Aug 18.
Tagebücher und PTBS
Eine kritische Krankheit kann zu mehreren anhaltenden Gesundheitsproblemen führen, bekannt als Post-Intensive-Care-Syndrome PICS einschließlich psychischer Morbidität. Sayde et al (2020) aus den USA implementierten ein Intensivtagebuchprogramm in zwei medizinischen und chirurgischen Intensivstationen, um PTBS, Angstzustände und Depressionen in einer randomisierten, kontrollierten Studie zu reduzieren. Eingeschlossen waren PatientInnen mit einem erwarteten Aufenthalt auf der Intensivstation >72h und >24h Beatmung. Tagebücher wurden von MitarbeiterInnen und Familien geschrieben. Tagebücher waren am Krankenbett und wurden von den PatientInnen auf eigenen Wunsch gelesen. Das Studienteam besuchte PatientInnen, um Fragen zu beantworten und Familien und PatientInnen über PICS aufzuklären. Die PatientInnen wurden randomisiert zu Aufklärung & Tagebuch (Intervention) oder nur Aufklärung (Kontrolle). Im Ergebnis absolvierten 18, 13 und 5 PatientInnen innerhalb der Interventionsgruppe die Basis-, 4-Wochen- und 12-Wochen-Evaluierung; in der Kontrollgruppe waren dies 17, 12, 8 PatientInnen. Das primäre Ergebnis PTBS war in der Interventionsgruppe zu Beginn nicht signifikant höher. Beide Gruppen hatten eine klinisch signifikante PTBS von 36% in Woche 4 und 70% in Woche 12. Die Veränderungen der PTBS-Werte zwischen den verschiedenen Zeitpunkten waren in der Kontrollgruppe signifikant besser als in der Interventionsgruppe, insbesondere im Aspekt der vegetativen Übererregtheit. Die PatientInnen in der Kontrollgruppe erholten sich besser. Auch die Reduktion der depressiven Symptome war in der Kontrollgruppe besser, andere Variablen blieben ähnlich. Die AutorInnen diskutieren diesen Punkt mit einer kleinen Stichprobengröße und einer Hypothese, dass PatientInnen mit besonderer Übererregtheit behandlungsresistenter sein könnten. Die AutorInnen schlussfolgern: „Was unsere Arbeit deutlich macht, ist, dass die psychologischen Bedürfnisse und PICS-Symptome der Überlebenden nach der Entlassung chronisch und weit verbreitet sind und verbesserte Anstrengungen in den Bereichen Prävention, Bildung, Behandlung und Zugang zur Versorgung verdienen. "
Sayde GE, Stefanescu A, Conrad E, Nielsen N, Hammer R. Implementing an intensive care unit (ICU) diary program at a large academic medical center: Results from a randomized control trial evaluating psychological morbidity associated with critical illness. Gen Hosp Psychiatry. 2020 Jul 2; 66: 96-102.
Intensivtagebücher in Indien
Für Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen wie Indien könnte die Verwendung von Tagebüchern auf der Intensivstation aufgrund anderer soziokultureller Bedingungen oder des Problems von Analphabetismus eine Herausforderung darstellen. Tripathy et al. (2020) implementierten Tagebücher auf einer gemischten Intensivstation in Indien. Die AutorInnen führten eine qualitative Studie durch, um die Bedeutung der Tagebücher für Familien und PatientInnen zu untersuchen. Sie fanden heraus, dass jüngere und gebildete Verwandte die Idee besser annahmen. Das Tagebuch wurde als neuartige Hilfe zur Kommunikation und als spiritueller Rahmen angesehen und änderte ihre Sicht auf das Personal. Sie entwickelten ein tieferes Verständnis für den Umgang mit kritischen Krankheiten und konnten Emotionen wie Hoffnung, Angst, Schuld und andere ausdrücken. Nach der Entlassung wurde das Tagebuch für den Informationsaustausch innerhalb sozialer Gruppen verwendet. Überhaupt wurde das Tagebuch von PatientInnen und Familien gut angenommen. Die AutorInnen schlussfolgern: "Mit weniger gebildeten, zugegebenen schüchternen Mitgliedern einer Gesellschaft, in der 'Tagebuch schreiben' nicht kulturell verbreitet ist, war die Wertschätzung für das neuartige Konzept universell."
Tripathy S, Acharya SP, Sahoo AK, Mitra JK, Goel K, Ahmad SR, Hansdah U. Intensive care unit (ICU) diaries and the experiences of patients' families: a grounded theory approach in a lower middle-income country (LMIC). J Patient Rep Outcomes. 2020 Jul 23; 4(1): 63.
Andere relevante Studien
Ein Fragebogen zur Beurteilung der Bereitschaft der PatientInnen, ihre Geschichte zu erzählen
Die eigene Gesundheitsgeschichte mit allen Aufs und Abs, Halluzinationen, Hoffnungen und Enttäuschungen zu erzählen, könnte für viele PatientInnen eine Herausforderung sein. Ashdown & Maniate (2020) entwickelten einen 20-Punkte-Fragebogen, um die Bereitschaft der PatientInnen zu bewerten, ihre Geschichte zu diskutieren. Dies ist ein erster Versuch, der Fragebogen ist noch nicht validiert, enthält aber viele gute Fragen, wie zum Beispiel: „Ich habe einen Plan, wie ich damit umgehen würde, wenn das Erzählen meiner Krankheitsgeschichte mich zu einer starken emotionalen Reaktion veranlassen würde.", „Ich habe darüber nachgedacht, wie ich reagieren würde, wenn das Publikum während meines Vortrags nicht zuhört und/oder abgelenkt ist.", oder „Ich habe über persönliche Dinge nachgedacht und welche Teile meiner Gesundheitsgeschichte ich teilen möchte und/oder nicht.". Der Fragebogen kann vor Forschungsgesprächen, Gruppentreffen oder Konferenzen verwendet werden und ist ein interessantes Instrument. Und vielleicht möchte jemand eine Validierungsstudie durchführen?
Free full text: Ashdown, L. C., & Maniate, J. M. (2020). Determining Patient Readiness to Share Their Healthcare Stories: A Tool for Prospective Patient Storytellers to Determine Their Readiness to Discuss Their Healthcare Experiences. Journal of Patient Experience.
Outcome von pflegenden Angehörigen
Cameron et al (2020) führten eine Forschung mit 280 pflegenden Angehörigen von IntensivpatientInnen durch, die zumindest für eine Woche auf der Intensivstation beatmet und später entlassen worden waren. Die Gesundheit der Angehörigen wurde ein Jahr nach der Entlassung von der Intensivstation beurteilt. Im Ergebnis betrug das Durchschnittsalter der pflegenden Angehörigen 53 Jahre, 70 % waren Frauen und 2/3 kümmerten sich um eine/n EhepartnerIn. 67% hatten anfangs eine Depression. Nach einem Jahr wurde bei 43 % eine Depression diagnostiziert, insbesondere bei Angehörigen, die jünger waren, weniger soziale Unterstützung hatten und weniger Kontrolle über ihr Leben und andere Faktoren hatten. Interessant: Es konnten keine PatientInnenvariablen wie Alter, Beatmungsdauer o.ä. identifiziert werden, die mit dem Ergebnis der Depression in Verbindung gebracht werden könnten. Die Studie zeigt, dass pflegende Angehörige von überlebenden IntensivpatientInnen wie die PatientInnen selbst einer nachhaltigen Unterstützung bedürfen.
Cameron JI, Chu LM, Matte A, Tomlinson G, et al. One-Year Outcomes in Caregivers of Critically Ill Patients. N Engl J Med. 2016 May 12; 374(19): 1831-41.
COVID-19
Eine alternative Betrachtungsweise von psychischen Symptomen während der Pandemie
Rajkumar diskutiert die Bewertung psychischer Symptome während der Pandemie. Für die Intensiv- und Notfallmedizin ist sein kurzer Kommentar vor allem vor dem Hintergrund relevant, dass für die “Front-line-Healthcare-Workers” eine erhöhte psychische Belastung angenommen wird. So hinterfragt der Autor einerseits die lineare Wirkungsbeziehung zwischen dem Einfluss der Pandemie und dem Auftreten psychischer Symptome. Er empfiehlt eine genauere Analyse und die Überprüfung anderer als den postulierten linearen Zusammenhängen und regt damit zu einer kritischen Hinterfragung der Prämisse “Je intensiver die Pandemie, desto intensiver die psychischen Auswirkungen” an. Vergessen würden dabei beispielsweise kollektive Adaptionsprozesse, die Gesellschaften im Rahmen von Katastrophen vollziehen und die eine Anpassung an neue Umstände gewährleisten.
Als zweiten Punkt diskutiert er das syndromale Auftreten von psychischen Symptomen als adaptive Strategien, die prinzipiell sinnvolles, vorsichtiges, bedachtes Verhalten in der Pandemie unterstützen. Die Schwierigkeit besteht allerdings darin adaptive von maladaptiven Strategien zu unterscheiden, wann also eine Angst Verhalten sinnvoll beeinflusst und wann sie sich eher zu stark einschränkend auf das Individuum auswirkt. Hier sei eine nähere Betrachtung der Risiko- und Resilienzfaktoren wichtig, um die spezifische Wahrscheinlichkeit für einen maladaptiven Umgang besser beurteilen zu können.
Zuletzt weist der Autor darauf hin, dass psychische Erkrankungen während der Pandemie nicht isoliert betrachtet, sondern vor dem Hintergrund der sie verursachenden Faktoren bewertet und behandelt werden müssten. Insbesondere sieht er die wirtschaftlichen Folgen für alle betroffenen Personen als in Zusammenhang mit einer psychischen Belastung stehend an. Daher sei eine isolierte Behandlung psychischer Symptome ohne Beachtung des weiteren Kontextes (u.a. sozial, ökonomisch) nicht zielführend.
Rajkumar RP. Depressive Realism and Functional Fear: An Alternative Perspective on Psychological Distress During the COVID-19 Pandemic. Prim Care Companion CNS Disord. 2020 Jul 23; 22(4): 20com02714.
Mit Kindern über Krankheit und den Verlust von nahen Angehörigen während der Pandemie sprechen
In einem Kommentar geben ÄrztInnen und PsychologInnen der Universität Oxford Empfehlungen für die Kommunikation mit Kindern kritisch kranker (COVID19)-PatientInnen. Diese dürfen häufig nicht besucht bzw. während des Versterbens begleitet werden, was sich auch auf minderjährige Kinder der PatientInnen (z.B. eigene Kinder, Enkelkinder, Nichten, Neffen) auswirkt. Kinder als Angehörige sind häufig „unsichtbar” für das intensivmedizinische Behandlungsteam. Die Art und Weise der Kommunikation über eine lebensbedrohliche Erkrankung und über den Tod hat aber Einfluss auf das psychische Wohlbefinden der Kinder im Langzeitverlauf. Daher sollte das Behandlungsteam die Kommunikation innerhalb der Familie so unterstützen und fördern, dass Kinder altersangemessene und wahrheitsgemäße Informationen erhalten. Die Kommunikation sollte dabei den jeweiligen kindlichen Entwicklungsstand und das Krankheits- sowie Todesverständnis berücksichtigen. Des Weiteren sollten die Informationen konkret und ohne Verwendung von schwer verständlichen Redewendungen sein. Es sollte stets bedacht werden, dass die Vorenthaltung von Informationen – vermeintlich zum Schutz der Kinder – dazu führt, dass Kinder eigene Theorien entwickeln und Schlussfolgerungen aus dem ziehen, was sie wahrnehmen, z.B. Stimmung der Bezugspersonen, dauerhafte Abwesenheit des erkrankten Angehörigen. Eltern wünschen sich Unterstützung vom Personal hinsichtlich der Frage, wie sie mit ihren Kindern sprechen sollen.
Rapa E, Dalton L, Stein A. Talking to children about illness and death of a loved one during the COVID-19 pandemic. Lancet Child Adolesc Health. 2020 Aug; 4(8): 560-562.
Die COVID-19-Pandemie veränderte nicht die Zahl, aber die Art psychiatrischer Notfälle
Aly und KollegInnen von der TU München untersuchten Veränderungen in der Anzahl psychisch belasteter PatientInnen, die in der Notaufnahme vorstellig wurden, in dem sie die Daten aus dem Zeitraum des Lockdowns mit einem Referenzzeitraum verglichen. Zusätzlich wurden retrospektiv die psychiatrischen Konsilanforderungen hinsichtlich eines thematischen Bezuges zur COVID19-Pandemie untersucht. Die AutorInnen stellten fest, dass sich die absolute Anzahl von Vorstellungen von PatientInnen in der ZNA während des Lockdowns gegenüber dem Referenzzeitraum verringerte, dass es aber eine Zunahme an Kodierungen psychischer Erkrankungen gab. Der Anteil an psychischen ICD-10- Hauptdiagnosen veränderte sich von 3 auf 5% im Vergleich zum Referenzzeitraum. In den Konsilanforderungen war ein mit 21% stark erhöhter Anteil an PatientInnen mit Suizidversuchen aufgrund einer Belastung in Zusammenhang mit der Pandemie zu verzeichnen. Die AutorInnen geben hier allerdings zu bedenken, dass die absolute Anzahl an Konsilen bei n=49 lag und daher zu gering ist, um eine detaillierte Analyse von Subgruppen vorzunehmen. Die Ergebnisse geben somit Hinweise auf das Ausmaß psychischer Belastungen infolge der Pandemie, sollten aber anhand einer größeren Erhebung an verschiedenen Kliniken validiert werden.
Aly L, Sondergeld R, Hölzle P, et al. Die COVID-19-Pandemie veränderte nicht die Zahl, aber die Art psychiatrischer Notfälle: Versorgungsdaten aus Vergleichszeiträumen von 2019 und 2020 [The COVID-19 pandemic has not changed the number but the type of psychiatric emergencies: A comparison of care data between 2019 and 2020. Published online ahead of print, 2020 Jul 24. Nervenarzt. 2020;1-3. doi: 10.1007/s00115-020-00973-2.
Verfasst von:
Dr. Teresa Deffner, Dipl.-Rehapsych. (FH), Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin, Universitätsklinikum Jena
Dr. Peter Nydahl, RN MScN, Pflegeforschung; Klinik für Anästhesie und operative Intensivmedizin, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Kiel